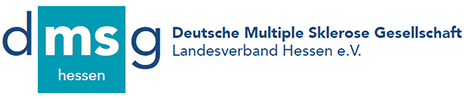Ein Gastbeitrag, der bereits vor einigen Monaten schon einmal in der DABEI veröffentlicht wurde.
Von Dr. med. Christoph Kreck
Positive Berichte über den therapeutischen Nutzen von Sonnenlicht, meist in Verbindung mit Vitamin D, gibt es immer wieder in Zeitschriften, im Internet oder in der medizinischen Fachliteratur. Zum Nutzen und Schaden des Sonnenlichts sind die Positionen in der Wissenschaft noch recht einhellig. Bei Vitamin D gehen sie dagegen weiter auseinander. In einer längeren Version dieses Beitrags auf der Website der DMSG Hessen werden die Ausführungen in der aktuellen Leitlinie zur MS mit einigen Grundlagen zu Vitamin D bei MS herangezogen (Link siehe unten). Die digitale Version geht auch auf den historischen Hintergrund ein und sie enthält eine tabellarische Darstellung
der verschiedenen Lichtquellen.

Unter Vitamin D versteht man eine Gruppe fettlöslicher Steroide. Physiologisch wird unter Lichteinfluss Calciol (Vitamin D3) in der Haut gebildet und in der Niere in das aktive Hormon Calcitriol umgewandelt. Dieses ist in erster Linie an der Regulation des Knochenstoffwechsels beteiligt. Die individuelle Vitamin-D-Versorgung lässt sich anhand des Calcidiol-Spiegels im Blut überprüfen, der bei gesunden Erwachsenen mehr als 30 nmol/l betragen sollte.

Bei Studien muss zwischen den Zielen der Prophylaxe der MS und der Therapie einer bestehenden MS unterschieden werden. Epidemiologische Studien zeigen ein häufigeres Auftreten der MS in Breitengraden mit geringerer Sonnenlichtexposition. Es gibt Hinweise, dass der Vitamin D-Spiegel auch einen Einfluss auf Krankheitsschwere und -verlauf der Multiplen Sklerose haben könnte.
Nach der Leitlinie kann daher bei Patientinnen/-en mit MS und normalen Vitamin D-Spiegeln eine Vitamin D-Supplementation erwogen werden. Eine Selbstmedikation sollte allenfalls in niedriger Dosierung erfolgen. Allerdings ist ein positiver Effekt dieser Behandlung nicht bewiesen
Weitere Aspekte, die man bei den Themen Sonnenlicht und Vitamin D bei MS beachten sollte, sind das erhöhte Osteoporoserisiko für Frauen, bei fortgeschrittener MS das erhöhte Frakturrisiko durch Stürze, die eingeschränkte Aktivität und Mobilität, oft verbunden mit Leben in geschlossenen Räumen, und bei vielen Betroffenen häufigere Cortisonpulstherapien.

Gründe für gemäßigtes Sonnen im Spätherbst und Winter sind ein positiver Einfluss auf die Stimmung, und es ist günstig für die Aktivität und für
den Vitamin D-Stoffwechsel. Aber es gibt auch Gründe für besondere Vorsicht bei hellem Hauttyp und bei Einnahme licht-sensibilisierender Arzneimittel. Zu wenig Sonnenlicht bzw. UV-B führt zu einer mangelhaften Vitamin D-Produktion, was mit einem erhöhten Risiko, an MS zu erkranken in Verbindung gebracht wurde.